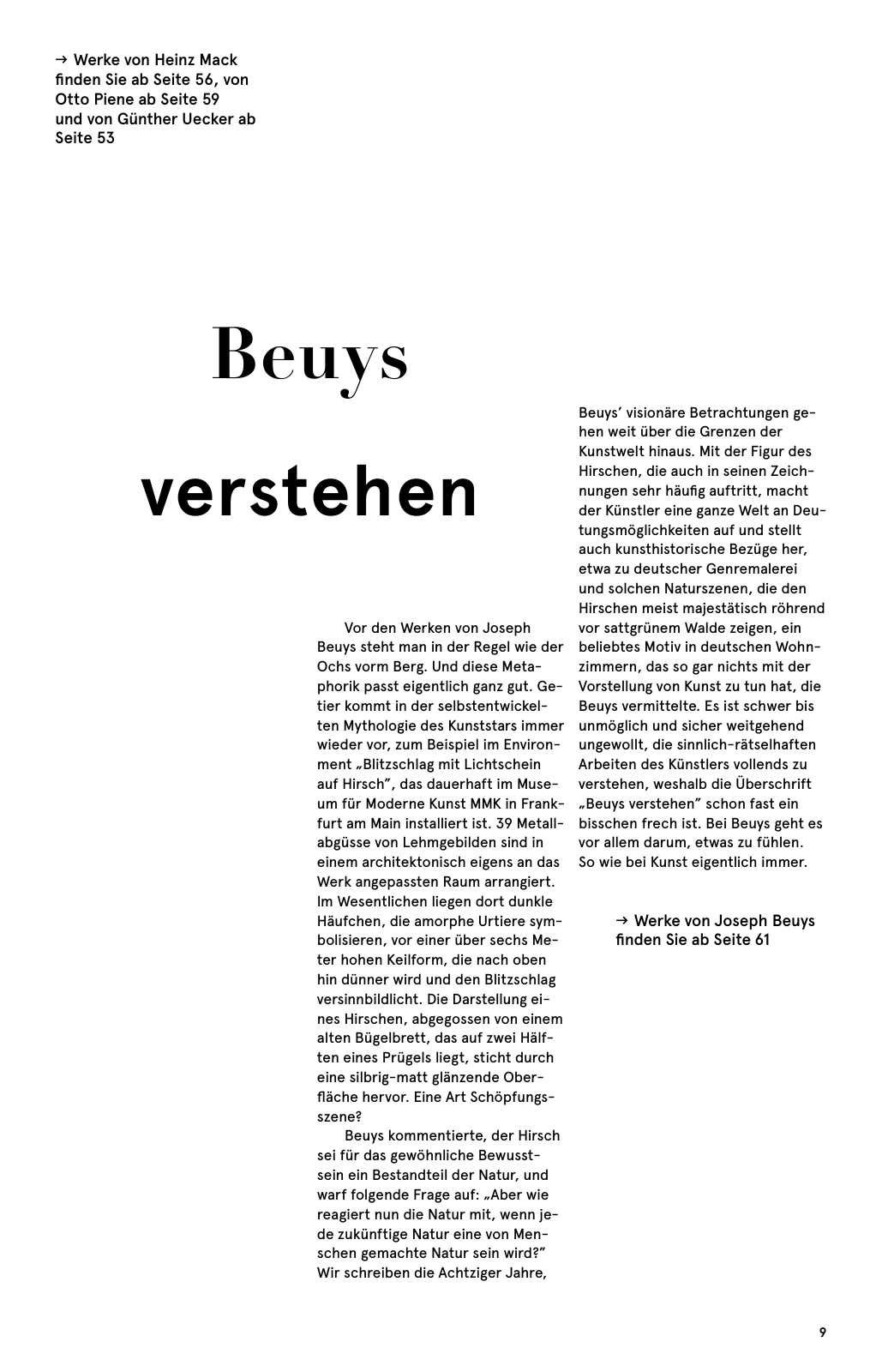ARTES Katalog Winter 2014/15 - Neue Version Seite 9
Hinweis: Dies ist eine maschinenlesbare No-Flash Ansicht.Klicken Sie hier um zur Online-Version zu gelangen.
Inhalt
9Beuys verstehen Vor den Werken von Joseph Beuys steht man in der Regel wie der Ochs vorm Berg Und diese Meta phorik passt eigentlich ganz gut Ge tier kommt in der selbstentwickel ten Mythologie des Kunststars immer wieder vor zum Beispiel im Environ ment Blitzschlag mit Lichtschein auf Hirsch das dauerhaft im Muse um für Moderne Kunst MMK in Frank furt am Main installiert ist 39 Metall abgüsse von Lehmgebilden sind in einem architektonisch eigens an das Werk angepassten Raum arrangiert Im Wesentlichen liegen dort dunkle Häufchen die amorphe Urtiere sym bolisieren vor einer über sechs Me ter hohen Keilform die nach oben hin dünner wird und den Blitzschlag versinnbildlicht Die Darstellung ei nes Hirschen abgegossen von einem alten Bügelbrett das auf zwei Hälf ten eines Prügels liegt sticht durch eine silbrig matt glänzende Ober fläche hervor Eine Art Schöpfungs szene Beuys kommentierte der Hirsch sei für das gewöhnliche Bewusst sein ein Bestandteil der Natur und warf folgende Frage auf Aber wie reagiert nun die Natur mit wenn je de zukünftige Natur eine von Men schen gemachte Natur sein wird Wir schreiben die Achtziger Jahre Beuys visionäre Betrachtungen ge hen weit über die Grenzen der Kunstwelt hinaus Mit der Figur des Hirschen die auch in seinen Zeich nungen sehr häufig auftritt macht der Künstler eine ganze Welt an Deu tungsmöglichkeiten auf und stellt auch kunsthistorische Bezüge her etwa zu deutscher Genremalerei und solchen Naturszenen die den Hirschen meist majestätisch röhrend vor sattgrünem Walde zeigen ein beliebtes Motiv in deutschen Wohn zimmern das so gar nichts mit der Vorstellung von Kunst zu tun hat die Beuys vermittelte Es ist schwer bis unmöglich und sicher weitgehend ungewollt die sinnlich rätselhaften Arbeiten des Künstlers vollends zu verstehen weshalb die Überschrift Beuys verstehen schon fast ein bisschen frech ist Bei Beuys geht es vor allem darum etwas zu fühlen So wie bei Kunst eigentlich immer Ȇ Werke von Joseph Beuys finden Sie ab Seite 61 Ȇ Werke von Heinz Mack finden Sie ab Seite 56 von Otto Piene ab Seite 59 und von Günther Uecker ab Seite 53